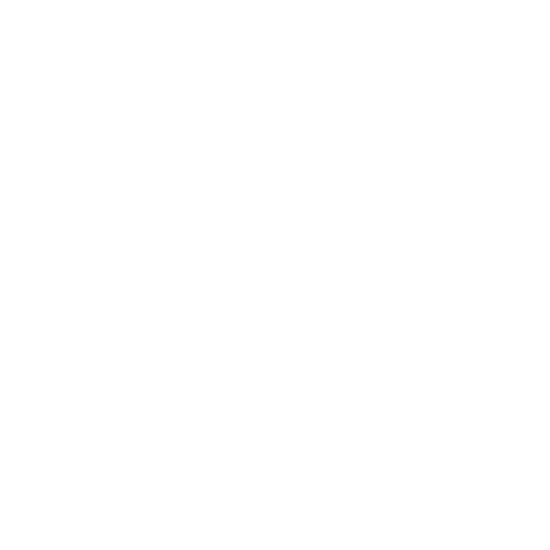Rundweg
-
Die Weißstörche in Ellerdorf
-
Meiereiteich und Dorfplatz
-
Ellerdorfs alte Schule
-
Die Sage von den Unterirdischen
-
Biogas aus Reststoffen und nachwachsenden Rohstoffen
-
Die Ellerdorfer Moore
-
Die Binnendüne
-
Der Windpark Bokel - Ellerdorf
-
Der Ochsenweg
Eröffnung
Am 6. Juni 2015 trafen sich bei perfektem Wetter rund 50 Ellerdorfer um gemeinsam mit Bürgermeister Dr. Frank Steinmann, dem Kulturausschußvorsitzenden Joachim Müller-Hansen und NDR Wetterexperte Meeno Schrader den neuen Ellerdorfer Rundweg zu eröffnen. Klar, dass Nortorf-Video mit dem Wetterschnack nicht fehlen durfte. Helmut Böttcher aus Nortorf hat zur Eröffnung des Ellerdorfer Rundweges am 06. Juni 2015 ein kleines Video gedreht und unter Youtube ins Internet gestellt.